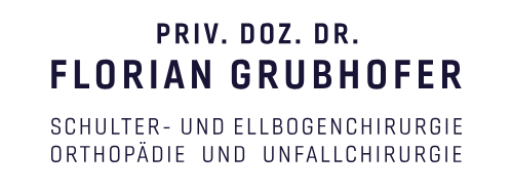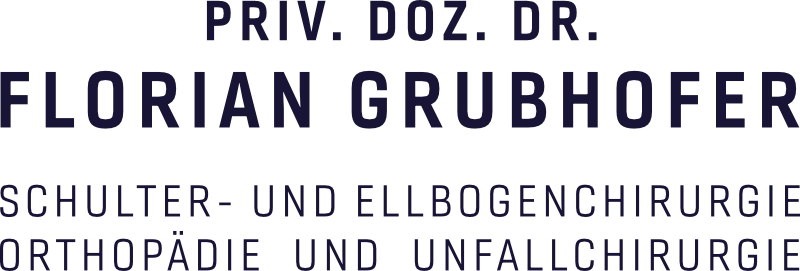Was ist eine AC-Gelenksverletzung?
Das sogenannte AC-Gelenk (Acromioclaviculargelenk) ist die Verbindung zwischen dem Schlüsselbein (Klavikula) und dem Schulterblatt (Acromion = Schulterblattdach). Es wird durch Bänder stabilisiert: einerseits durch die direkten Bänder des Gelenks selbst (AC-Bänder) und andererseits durch die korakoklavikulären Bänder, welche das Schlüsselbein mit dem Rabenschnabelfortsatz (Korakoid) des Schulterblatts verbinden.
Eine Verletzung des AC-Gelenks kann sowohl die direkten Gelenkbänder als auch die korakoklavikulären Bänder betreffen. Je nach Schweregrad können diese gezerrt oder komplett gerissen sein.
Welche Klassifikationen werden verwendet?
Die Schwere einer AC-Gelenksverletzung wird häufig anhand der Rockwood-Klassifikation eingeteilt:
- Grad I: Zerrung der AC-Bänder. Keine Vergrößerung des Gelenkspaltes im Röntgenbild.
- Grad II: Riss der AC-Bänder, jedoch intakte CC-Bänder. Das Schlüsselbein ist leicht gegenüber dem Acromion verschoben, ragt aber nicht über das Schulterdach hinaus.
- Grad III: Riss der AC- und CC-Bänder. Das Schlüsselbein ragt über das Schulterdach hinaus, jedoch beträgt der Abstand zwischen Korakoid und Schlüsselbein weniger als 25 mm.
- Grad IV: Hintere Verschiebung der Klavikula (meist sichtbar in der axialen Röntgenaufnahme).
- Grad V: Ähnlich wie Grad III, jedoch mit einem Abstand von über 25 mm zwischen Korakoid und Schlüsselbein.
- Grad VI: Sehr seltene Verletzung, bei der das Schlüsselbein unter das Korakoid oder das Acromion verschoben ist.
Wie wird eine AC-Gelenksverletzung behandelt?
- Grad I und II: Konservative Behandlung mit Schonung, Schmerztherapie und Physiotherapie.
- Grad IV, V und VI: Operative Behandlung, insbesondere bei aktiven Patienten.
- Grad III: Individuelle Entscheidung, abhängig von den funktionellen Anforderungen des Patienten. Eine operative Stabilisierung kann direkt erfolgen, alternativ wird zunächst eine konservative Therapie versucht. Bei persistierenden Schmerzen oder Funktionsstörungen kann eine spätere Operation notwendig sein.
Welche Operationstechniken werden angewandt?
Es gibt mehr als 130 beschriebene Techniken zur Stabilisierung des AC-Gelenks. Die bevorzugte Technik umfasst:
- Stabilisierung zwischen Korakoid und Klavikula mittels eines Fadenankers.
- Der Anker wird unterhalb des Korakoids angebracht und mit nicht resorbierbaren Fäden beladen.
- Eine „Cow Hitch-Cerclage“ stabilisiert das Gelenk, indem die Fäden zwischen Korakoid und Klavikula verspannt werden.
- Bei chronischen Verletzungen: Zusätzliche achterförmige Sehnenrekonstruktion zwischen Korakoid und Klavikula.
- Bei horizontalen Instabilitäten: Erweiterung der Sehnenrekonstruktion auf das AC-Gelenk selbst.
Wie sieht die Nachbehandlung aus?
- Ruhigstellung: Sechs Wochen in einer Schlinge, um die Heilung zu ermöglichen.
- Bewegungstherapie: Beginn nach sechs Wochen, jedoch ohne Kräftigungsübungen.
- Kräftigung: Ab Woche 12, jedoch ohne axiale Belastungen (z. B. Liegestütze oder Bankdrücken) bis 24 Wochen postoperativ.
Risiken der konservativen und operativen Behandlung
- Konservative Behandlung:
- Risiko einer bleibenden Instabilität, die die Überkopffunktion beeinträchtigen kann.
- Ein Gefühl, dass der Arm nicht richtig verbunden ist, kann bei einigen Patienten auftreten.
- Funktionelle Defizite sind erst nach 6–12 Wochen abschätzbar.
- Operative Behandlung:
- Instabilitätsrezidiv: Sehr selten (unter 5%).
- Nachsinterung: Ein leichter Hochstand der distalen Klavikula kann ästhetisch störend sein, führt aber meist nicht zu funktionellen Einschränkungen.
- Störendes Fremdmaterial im Bereich des Schlüsselbeins. Allgemeine Operationsrisiken: Wundheilungsstörungen, Infektionen, Blutergüsse